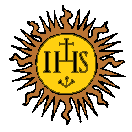 |
Texte auf Deutsch |
===========================================================================
"Ein
Jude, wer ist das?" Vom jüdischen Selbstverständnis Friedrich Georg Friedmanns,
in: Universitätsreden, Universität Augsburg 1997, S. 564-74
===========================================================================
VOM JÜDISCHEN SELBSTVERSTÄNDNIS FRIEDRICH GEORG FRIEDMANNS
In meiner Heimat, wo einst Jahrhunderte lang Polen und viele Juden gemeinsam lebten, aber vielleicht noch stärker in Deutschland, wo eine fruchtbare deutsch-jüdische Symbiose mit einem Hermann Cohen, Franz Rosenzweig oder Martin Buber zustande kam, ist die Frage, die meine Überlegungen leitet - "Ein Jude, wer ist das?" - eine Frage nach dem abwesenden Nachbarn. Hinzu kommt, daß es sich um einen Nachbarn handelt, den man zur "rechten Zeit" nicht kennengelernt und nicht verstanden, ja sogar vielleicht gründlich mißverstanden hat. So scheint diese Frage zunächst einen Nachholbedarf zu signalisieren. Das gilt insbesondere für die Nachkriegsgeneration, deren Angehörige infolge der Vernichtung der europäischen Juden kaum persönlich und bewußt einem Juden begegnen, geschweige denn vom jüdischen Leben eine bleibende Wahrnehmung haben konnten. Das gilt aber auch für die ältere Generation, die infolge ihrer Verstrickung in die unheilvolle Zeit zum Selbstschutz manchen Panzer angelegt hat und nicht selten sich im geschlossenen Kreis ihrer Vorstellungen bewegt. Obwohl ich diese Frage nicht als Ausdruck der Befangenheit verstehen möchte, die das christlich-jüdische Verhältnis immer noch hemmend bedingt, so bin ich davon überzeugt, daß die Überwindung der vorhandenen Befangenheit nicht ohne wiederholte Versuche, diese Frage zu beantworten, gelingen kann.
Der angesprochene Nachholbedarf resultiert aber nicht nur aus der historischen Tatsache, daß wir kaum Juden als unsere Nachbarn mehr haben. Denn das Bedürfnis, den Juden als Juden kennenzulernen und sein Judesein zu verstehen, und zwar als etwas lebendiges und nicht als ein Museumsstück, entspringt auch aus einem christli-chen Grundanliegen, das vielen Christen in den letzten Jahrzehnten sehr wichtig wurde, nämlich aus dem Versuch der Neubestimmung der christlichen Identität durch eine Rückbesinnung auf die Urquellen der christlichen Erfahrung. So verdichtet sich für einen gläubigen Christen die Frage nach dem Juden als dem abwesenden Nachbarn zu einer existentiellen Frage nach dem eigenen, christlichen Selbstverständnis. Der Weg der christlichen Identitätsfindung durch negative Abgrenzung zum Judentum, das zu diesem Zweck zum Schreckgespenst einer bloßen Gesetzesreligion verdreht werden mußte, hat sich als Irrweg erwiesen, weil er den Zugang zum Verständnis der Person Jesu, seines Gottesbildes und seiner Verkündigung versperrt und darüber hinaus in offensichtlicher Verletzung des höchsten Liebesgebotes der Judenfeindschaft den Vorschub leistet. Dieser Weg wurde in der christlichen Frühzeit durch Marcion radikal beschritten und trotz des Widerstandes des kirchlichen Lehramtes finden wir ihn bis auf heutigen Tag als Mittel der christlichen Identitätsfindung bei Denkern und Theologen.
Es gibt aber noch eine weitere Dimension der Frage nach dem Judesein heute, die nicht mehr auf den wie auch immer motivier-ten Nachholbedarf zurückgeführt werden kann. Denn unabhängig davon, ob wir gläubige Christen sind oder nicht, ist es nach der Shoah nicht mehr möglich, die Frage nach dem Sinn der eigenen Existenz von der Frage nach dem Bruder, nach dem Nächsten, nach dem Anderen zu trennen. Die Frage nach dem Juden als Juden, nach seinem Judesein wird damit in einem gewissen Sinne zu einer Chiffre für das Problembewußtsein einer Philosophie, die ihren Sinn darin sieht, daß sie die Vernichtungslager und Gulags zu verhindern lehrt, oder anders ausgedrückt, daß sie die Beteiligung der Vernunft an der Rechtfertigung der Gewalt unmöglich macht. So erhält mein Versuch der Darstellung des jüdischen Selbstverständnisses von Prof. Friedrich Georg Friedmann seinen Platz im Vorfeld eines Denkens, das in der Begegnung von Ange-sicht zu Angesicht den Anspruch erfährt: du wirst nicht töten!
Mit diesen Hinweisen auf den weiten Horizont der Frage nach dem Judesein soll nicht die Erwartung geweckt werden, daß hier mehr angeboten werden kann als ein Zeugnis von einem jüdischen Leben inmitten der säkularisierten Gesellschaft, von dem Impulse aus-gehen für den unbefangenen Umgang von Juden und Chri-sten und für die Übernahme der Verantwortung für Gegenwart und Zukunft aus einer religiös begründeten Hoffnung. Wir haben damit den Rahmen gezeichnet, in dem nun das jüdische Selbstverständnis von Prof. Friedrich Georg Friedmann dargestellt werden kann.
2. Zurückgekehrter Nachbar
Wenn man im Lebenslauf von Prof. Friedmann liest, daß er - der gebürtige
Augsburger, Jahrgang 1912 - ab 1933 bis 1960 nacheinander in Rom, England
und in den USA lebte und tätig war und dort weiterhin erfolgreich hätte
wirken können; wenn man bedenkt, daß seine Eltern, die meisten Verwandten
und jüdischen Freunde die Nazizeit nicht überlebten, dann kann man es nachvollziehen,
wenn er sagt: "Ich hatte Glück in meinem Leben, viel Glück". Sicher beinhaltet
dieser Ausspruch viel mehr als die Tatsache des bloßen Überlebens. Erstaunlich
jedoch bleibt, daß Friedmann 1960 freiwillig nach Deutschland, an den "Ort
der mas-sivster Betrof-fenheit" zurück-kehrt, wo ihn doch alles daran erinnern
mußte, daß er ein Überlebender war; bis dahin, daß er sich fragte: "welche
Verdienste hatte ich, daß ich überleben durfte?" Da er keine besonderen
Verdienste fand, wurde ihm "Überleben zu Schuld". Was es mit diesem, für
den Außenstehenden schwer nachvollziehbaren Schuldgefühl gemeint ist, deutet
Friedmann mit einer Abfolge von Fragen an, die uns zeigen, daß er sein
Judesein in die Erfahrung des Menschengeschlechts eingebet-tet und vor
unbequemen Fragen ungeschützt weiß. Er fragt näm-lich:
"Wie konnte ich Abbitte leisten denen gegenüber, bei denen ich vielleicht versäumt hatte, sie durch eigenes Tun in den Kreis der Überlebenden hinüberzuretten? Welche Schuld trifft den, der als Teil eines Volkes, einer Kultur, einer Gemeinschaft versäumt hat, Kräfte zu wecken, die den Lauf der Geschichte hätten verändern können? Welche Schuld trifft den, der als Angehöriger der menschlichen Rasse teilhat an den Verbrechen derer, die ebenfalls der menschlichen Rasse angehörten?"Sein Überleben ist ihm aber nicht nur Anlaß, sich selbst und andere nach der Verantwortung für Vergangenes zu fragen, sondern noch in viel stärkerem Maße eine Art Verpflichtung, an der Entwicklung eines Vertrauensverhältnisses zu den jungen Menschen in Deutschland, "für die menschenwürdiges Überleben zentrales Anliegen ist" , mit allen Kräften zu arbeiten. Bei dieser Arbeit ging es ihm um mehr als um gegenseitige Achtung, nämlich auch um "Achtung vor dem gesamten Mysterium menschlichen Daseins" . So gewinnt für Friedmann sein Entschluß zur Rückkehr nach Deutschland allmählich den Sinn einer Sendung. Diese kristallisierte sich heraus auf der Basis der
"radikale[n] Ablehnung jeglichen Urteilens oder Moralisierens aus sicherer Ferne" unter dem Eindruck der "tägliche[n], erschütternde[n] und verwirrende[n] Begegnung mit Menschen, die in der einen oder anderen Weise die unaustilgbaren Spuren jener Zeiten zeigten, für deren Verständnis die Kategorien des Denkens und Urteilens, wie sie in der bisherigen Geschichte der Menschheit entwickelt worden sind, nicht ausreich-ten" .Sein Verständnis der (nicht nur) eigenen Aufgabe ist stark geprägt von der kritischen Diagnose des Versagens einer Gesell-schaft, in der "weder Betroffen-heit noch Bekehrung (...) einen Platz zu haben" scheinen , weil sie nicht durch die geistige Dynamik der "gegen-seitigen Selbstoffenbarung von Personen" beseelt ist, sondern durch "Austausch von Fakten" und durch das Ideal der technischen Machbarkeit beherrscht wird. Diese gesellschaftliche Entwicklung, die den Einzelnen der Bedrohung durch Sinnlosigkeit und Isoliertheit ausliefert, bringt Friedmann in Verbindung mit der Veränderung des Rationalitätsbegriffes in der Aufklärung und mit dem damit zusammenhängenden Verlust des Transzendenzbezuges. Die autonome, aufgeklärte Ratio behandelt die Wirklichkeit wie ein "Sammelsurium" von meßbaren und technisch beherrschbaren Daten und nicht mehr als "ein sinnvolles Ganzes", das gedeutet werden kann. Die sinnorientierte Vernunft, deren Auge die Liebe war, ist zum zweckorientierten, an willkürliche Interessen gebundenen Verstand geworden, der sich als unfähig erwiesen hat, sinn-stiftend (d. h. vermittelnd zwischen der Vielheit von Daten und dem sinnvollen Ganzen) oder gesellschaftlich integrierend zu wirken . Die ästhetischen Werte, mit ihrer hochstilisierten Zeitlosigkeit waren als Ersatz der Transzendenz unfähig, die zeitgebundene Verbindlichkeit zu begründen. Für Friedmann gilt es deshalb als sicher,
"daß das mangelnde Interesse des deutschen Bürgertums am politischen Geschehen, daß die mangelnde Zivilcourage und ähnliche Mangel-erscheinungen mit diesem Problem in Verbindung standen. (...) Es war wohl der Umgang mit den zeitlosen Werken und Werten der deut-schen Bildung, der dem deutschjüdischen Bürgertum sein Gefühl für die Dauerhaftigkeit und Unzerstörbarkeit, sei es der bürgerlichen Existenz, sei es der Symbiose mit deutscher Kultur und Gesellschaft gab."Diese Kritik an dem vorherrschenden Kultur- und Rationalitätsmodell gipfelt in der Feststellung, daß es "die Machtübernahme Hitlers nicht verhindert" und sogar die Gebildeten für den Nationalsozialismus anfällig gemacht hat. Sehr nüchtern fügt er hinzu, daß "jüdische Intellektuelle wohl nicht anders gehandelt hätten, hätte es keine Verfolgung der Juden gegeben". Im Einklang mit dieser Diagnose bestimmt Friedmann seine und seines deutschen Nachbars Aufgabe:
"Der Jude als Überlebender und sein für menschenwürdiges Überleben kämpfender Nachbar finden sich somit vor der gleichen Aufgabe: den absoluten Primat des rein zweckorientierten Verstandes abzubauen und der sinnvermittelnden, gesellschaftlich und politisch integrierenden Vernunft wieder ein größeres Maß an Geltung zu verschaffen."Friedmann ist überzeugt von der Möglichkeit der Überwindung der Herrschaft des zweckorientierten Verstandes und von der Möglichkeit der Wiederherstellung des sinngebundenen Zusammenhangs der menschlichen Wirklichkeit. Das soll geschehen durch die Wiedergewinnung des Transzendenzbezuges. Friedmann wird dadurch keineswegs zu einer Art Missionar, wohl aber zu einem sich nicht aufdrängenden Zeugen der Menschlichkeit, deren Kern der eschatologische Glaube an die Verheißung ist, die den sinnvollen Zusammenhang zwischen seinem Leben und Überleben und dem der Mitmenschen herstellt. Deshalb führte er die erkannte Sendung durch, indem er seinen jungen Studentinnen und Studenten über die Jahre der Universitätstätigkeit hinaus die Bedingungen für Begegnungen geschaffen hat, wo sie die Fähigkeit des hinhörenden Erfahrens und des offenbarenden Sprechens entdecken konnten.
"Worauf es mir ankommt" - schreibt er an die Benediktinerin S. Adelgundis Jaegerschmid - "ist zu verhindern, daß das Menschliche, also die Begegnung von Menschen in und aus gemeinsamer Not, Hoff-nung, Glaube, verloren geht."Offenbar hat diese Methode den Nerv der nach "menschenwürdigem Überleben" trachtenden Generation getroffen. In einem späteren Brief an S. Adelgundis bemerkt Friedmann nebenbei:
"Ich merke doch selbst, daß die jungen Leute nicht wegen meiner "Wissenschaft" zu mir kommen, sondern wegen der menschlichen Atmosphäre. Wissenschaft gibt es genug in der Welt, aber dieses andere eben nicht.-"Das Menschlichste, dessen Verlust es zu verhindern gilt, ist für Friedmann der Glaube, verstanden "als eine ursprüngliche Haltung des Menschen, die in der Achtung des anderen Menschen, der Schöpfung überhaupt, das Numinose verspürt." Der Glaube, der in der Achtung des anderen Menschen und der Schöpfung anhebt, bedeutet "unmittelbares Vertrauen", das "in etwa dem Vertrauen eines Kindes entspricht, das in die wundersame Wahrheit des Märchens glaubt." Wenn also Friedmann an einer Stelle die Überwindung der "absoluten Herrschaft der instrumentellen Vernunft" und die Einsetzung einer "durch Glauben erleuchteten Ratio" postuliert , meint er nicht die von der Autorität der Offenbarung her gedachte Ratio der Scholastik, sondern vielmehr den dialogischen Logos, die Sprachvernunft, die unter dem Anspruch der Wahrheit steht und ihren Weg zu ihr als Dienst an der Ver-ständigung und an der Verantwortung für das menschenwürdiges Überleben versteht. Im Grunde ist das ein Dienst an dem gesprochenen Wort, mit dem sich die Menschen gegenseitig offenbaren und anvertrauen, mit dem sie ihr Ja und ihr Nein der Verantwortung sprechen.
Der einst ausgeladene Nachbar ist also zurückgekehrt und nahm - trotz des starken Bewußtseins der eigenen "Verletzlichkeit" - die "'prophetische' Funktion" eines Zeugen der Verheißung auf sich, - einer Verheißung, die in Vergessenheit geriet oder verraten wurde, was den Menschen das Gefühl der Sinnlosigkeit brachte und den Totalitätsansprü-chen der Ideologien wehrlos auslieferte. Friedmann hat für diese bei dem Entschluß zur Rückkehr unbeabsichtigte und wohl auch ungeahnte Entwicklung, zu der ihn die ungenügende Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus und die Auflösungserscheinungen der menschlichen Wirklichkeit herausgefordert haben, einen hohen Preis bezahlt:
"Einerseits war es jetzt die Leugnung des Geschehenen von seiten deutscher Bürger, welche die Pietät verletzte, andererseits wurde eine Rückkehr nach Deutschland von nicht wenigen Juden als Verrat betrachtet; zum Verlust von Familienangehörigen durch das Naziregime kam die oft absolute Entfremdung gegenüber überlebenden Verwandten und Freunden."Daß er diesen Preis bezahlt hatte, spricht nicht nur für die Glaubwürdigkeit Friedmanns, sondern auch für die Notwendigkeit seiner Sendung.
3. Jüdisch-christliche "communio fidelium"
Obwohl Prof. Friedmann eindeutig als Jude, der überlebt hat, nach Deutschland
zurückkehrte, hat er sich dennoch nie als Repräsentant von irgend jemand
verstanden, auch nicht als Repräsentant des Judentums. Er erlebt diese
seine Nichtrepräsentativität als Einsamkeit und unteilbare Verantwortung
aber keineswegs als Isolierung , wobei er ganz bewußt keiner konkreten
Gemeinde angehört. Er möchte "nur Jude" sein und als "nur Jude" wirken
und ernstgenommen werden. Diese Entschlossenheit zum eigenen Judesein bei
gleichzeitigem Fernbleiben von jeder Form des organisierten jüdischen Lebens
hat den Stellenwert einer solidarischen Gemeinschaft des Überlebenden mit
den Opfern, die nur deshalb vernichtet wurden, weil sie eben "nur Juden"
waren. Das pietätvolle Gedenken der Opfer ist deshalb das erste Merkmal
der jüdischen Identität Friedmanns und seine erste Aufgabe als "nur Jude".
Sein Leben in Deutschland als "nur Jude" sollte also zunächst nur stummes
Zeugnis von einer Abwesenheit sein, von einer nicht mehr vorhandenen Gemeinde,
in die er hineingeboren wurde.
Wie hat sich aus dieser persönlichen, für den - man möchte fast sagen
- privaten Bereich gedachten Bestimmung die gesellschaftlich relevante
"'prophetische' Funktion" eines Zeugen der religiösen Verheißung herauskristallisiert?
Die kultur- und gesellschaftskritische Analyse mit ihrer klaren Diagnose
der negativen Folgen des Transzendenzverlustes bildet zwar einen Ansatzpunkt
für ein solches prophetisches Bewußtsein, vermag es aber allein nicht zu
erklären. Auch die jüdische Tradition des Gedenkens, in der er als "Mittler
des Gedenkens", durch den die "unverbrauchte Liebe der Toten lebendige
Gegenwart" wird , bewußt gestanden hat, mußte nicht unbedingt zur Annahme
einer in die Gesellschaft hineinwirkenden Sendung führen.
Ausschlaggebend scheinen hier zwei Faktoren zu sein, die Friedmanns
Leben neuorientiert haben und die seiner ganzen Aktivität seit der Emeritierung
1979 bis heute eine besondere Prägung geben. Der erste Faktor war das durch
Konzilsdiskussionen über die Beziehung der katholischen Kirche zum Judentum
angeregte Gespräch mit Karl Rahner, dem Konzilstheologen und Arbeitskollegen
an der Universität München. Der zweite Faktor war die Entdeckung des jüdischen
Denkers Franz Rosenzweig, dessen Konzeption der jüdischen Existenz als
"Exil" und die der jüdisch-christlichen Beziehung Prof. Friedmann sich
zu eigen machte. Diese Entdeckung geschah im Rahmen seiner Beschäftigung
seit 1979 mit den Ver-tretern der deutsch-jüdischen Kultur.
Friedmann kommt also zum Nachdenken über sein Judentum nicht durch
das Studium der Bibel und der alten jüdischen Traditionen, sondern durch
die Anregungen, die letzten Endes vom zweiten Vatikanischen Konzil und
von dem im 20. Jahrhundert wohl bedeutendsten jüdischen Denker ausgegangen
sind. Beide Anregungen hängen mit den Versuchen zusammen, die jüdischchristliche
Be-zie-hung auf neue solide theologische Grundlagen zu stellen. Es verwundert
also nicht, daß Friedmann seine Sendung als eine mit den Christen gemeinsame
Sendung versteht.
Bevor wir seine Auffassung von der Gemeinsamkeit zwischen Juden und
Christen analysieren, betrachten wir zuerst kurz die Aus-angslage. So wird
auch die Entwicklung sichtbar, die Friedmann in den letzten fast 30 Jahren
in dieser wichtigen Frage durchge-macht hat.
Rückblickend schreibt er zu dem Beginn seiner Besinnung auf das eigene
Judentum:
"Ich war etwa 55 Jahre alt, als ich mir zum ersten Mal in meinem Leben Gedanken über mein Judentum machte. Vor dieser Zeit betrachtete ich es als eine biographische Selbstverständlichkeit, die teils durch Abkunft und Erziehung, teils durch äußere Umstände gegeben war. Die Tatsache, daß ich mit Karl Rahner der gleichen Fakultät angehörte und er Peritus beim zweiten Vatikansichen Konzil war, führte dazu, daß ich mit ihm einmal ein Gespräch führte, in dem er mein Anliegen in treffender Weise als die Überwindung der Befangenheit zwischen Christen und Juden charakterisierte. Ich zog mich kurz danach einige Wochen in ein Bergdorf in Tirol zu-rück, um einige Bücher über jüdische Geschichte zu lesen und über meine Haltung zum Christentum bzw. zu meinen christlichen Freunden und Bekannten nachzudenken. Ich schrieb darauf einen Aufsatz in der Form eines Briefes an Karl Rahner, in dem ich versuchte, Befangenheit als Folge der verschiedenen Interpretationen der Heilsgeschichte durch Judentum und Christentum zu sehen."Die "biographische Selbstverständlichkeit" des jüdischen Selbstgefühls Friedmanns war zwar eine vom Haus aus vererbte und positiv empfundene, sie war aber in religiöser Hinsicht nicht besonders tief geprägt . Sie war vergleichbar mit der Selbstverständlichkeit der Achtung für die Werte der bürgerlichen Welt . Nach der ersten Besinnung über sein Judentum war er der Meinung, daß für ihn "der Glaube an die Erwählung (...) heute als Aufruf zu exemplarischer Lebensweise verstanden werden" kann . Demnach wäre die Grundlage christlichjüdischer Beziehung und Zusammenarbeit die Übernahme vor Gott einer größeren Verantwortung für das würdige Überleben. Für Rahner war diese humanististische Haltung eine ungenügende Grundlage der Beziehung von Juden und Christen, weil er sah, daß dabei das Geheimnis der göttlichen Erwählung und Verheißung, der göttliche Auftrag an Israel aufgegeben werden müßte. Rahners Einwände waren als Fragen formuliert:
"Aber kann der Christ vom Juden auch nur wünschen und hoffen, daß er (...) den Anspruch einer besonderen Erwählung und eines besonderen Anspruchs an die Welt aufgibt und aus seinem authenti-schen Wesen ausscheidet? Daß er sich als Humanist aus einem bestimmten Volkstum und einer bestimmten Geschichte versteht wie jederman?"Für einen Christen kann es laut Rahner nicht gleichgültig sein, ob sich der Jude "als Glied eines Volkes mit einer heilsgeschichtlichen Sendung" , die auch für Christen von größter Bedeutung ist, versteht oder nicht.
Wenn Friedmann auf die Einwände Rahners erst vor kurzem, also nach 28 Jahren eine ausdrücklich zustimmende Antwort gibt , dann bedeutet das nicht, daß er den Rahnerschen Anstoß nicht viel früher aufgenommen hat. Denn die Gemein-schaft der Juden und Christen ist für Friedmann, spätestens seit der Beschäftigung mit Franz Rosenzweig, eine heilsgeschichtliche und nicht bloß eine profan humanistische. Es ist eine Gemeinschaft der gläubi-gen Juden und Christen, die die göttliche Verheißung vertrauensvoll und je auf eigene Weise empfangen haben und daher bereit sind - ihre jeweilige Identität nicht preisgebend - eine gemeinsame Sendung in der heutigen Welt so wahrzunehmen, daß ihre gemeinsame Hoffnung den bedrohten Menschen zuteil werden kann. In diesem Sinne darf wohl diese Gemeinschaft von Juden und Christen, wie sie von Prof. Friedmann gedacht und gelebt wird, mit dem Namen einer communio fidelium bezeichnet werden. Sehen wir nun im einzelnen die Überlegungen Friedmanns, die diesen Schluß rechtfertigen.
Es sei noch darauf hingewiesen, daß Friedmann über sein Judentum und über seine Auffassung von jüdisch-christlichem Verhältnis keine fachtheologischen Gedanken systematisch entwickelt, sondern daß er sich im Rahmen einer existentiellen Suche nach der Vergewisserung über das Wesentliche bewegt. Diese Suche führt ihn immer wieder zu den Wurzeln seiner jüdischen Identität, die nicht eine Art von Reflex darauf ist, was andere Menschen von den Juden denken, sondern Ureigenes, in der jüdischen Tradition von Anfang an Gegenwärti-ges. Für Friedmann war das nicht eine Lehre oder Liturgie, sondern die "Tradition des Eingedenkseins, die mit den Stammesvätern beginnt und die ganze Vielfalt von Ereignissen einbezieht, da jüdische Menschen mit Gott haderten und um seinen Segen rangen" , dh. die mystische Erfahrung der frühen jüdischen Geschichte, wo Einzelne - wie Abraham, Rachel, Jakob oder Moses - "in der Gegenwart eines sie anrufenden Gegenüber" standen . Diese Art der Rückbesinnung auf urjüdische Erfahrungen erklärt es, warum das Judesein für Friedmann kein Attribut unter anderen Attributen, keine institutionell abgestützte Volkszugehörigkeit bedeutet, sondern eine Existenzweise meint. Für den Vollzug dieser Existenz ist einerseits die persönliche Annahme der auserwählenden Verheißung Gottes an Abraham und dessen Nachkommen und andererseits die Bewährung der empfangenen Hoffnung durch weltgültige Näch-stenliebe, solange die Erfüllung aussteht, entscheidend. Dieses Selbstverständnis läßt keinen Raum für Selbstgerechtigkeit und erlaubt eine klare Trennung der religiösen und der politischen Aspekte des jüdischen Lebens.
Daß für Prof. Friedmann Judentum und Christentum "zwei Modi oder Stile des Gedenkens an die Verheißung" sind, hängt mit seiner Übernahme des von Franz Rosenzweig formulierten Glaubens zusam-men, wonach "am Ende der Tage Christus und der jüdische Messias identisch sein werden" . In der Geschichte bleiben laut Rosen-zweig Juden-tum und Christentum getrennt und eigenständig, obwohl zugleich voneinander geheimnisvoll abhängig durch ihren Bezug auf dieselbe eschatologische Verheißung und durch ihre sich ergänzende heils-ge-schichtlichen Aufgaben gegenüber der Welt. Friedmann übernimmt diese Konzeption Rosenzweigs, der für ihn übrigens kein "Forschungsobjekt" im üblichen Sinne geworden war .
Schon im Mai 1981 schreibt er in diesem Sinne an die inzwischen dem Hause Friedmann eng verbundene S. Adelgundis Jaegerschmid und zieht daraus Konsequenzen für eigene Auffassung des jüdisch christlichen Dialogs:
"Das Verhältnis Christentum und Judentum - im Guten wie im Bösen - scheint mir eines der allerletzten Mysterien zu sein. (...) Ich glaube wie Rosenzweig und andere, daß der Univer-salismus der Juden (...) das Christentum brauchte, um den anderen Völkern das zu geben, was von Anfang an im Judentum angelegt war, die Ausrichtung des Lebens auf das göttliche Reich am Ende der Tage. Ich verstehe deshalb den neuen Erzbischof von Paris vollständig, wenn er sagt: ich bin und blei-be Jude. Wenn ich gegen die üblichen jüdisch-christlichen Gespräche bin, so ist es, weil es sich hier nicht um ein intellektuelles, sondern mystisches Problem handelt."Der Dialog, der dem "Mysterium" des heilsgeschichtlichen Verhältnisses von Juden und Christen gerecht werden soll, muß
"über den konventionellen christlich-jüdischen 'Dialog' hinaus den anderen nicht nur in seiner Eigenart anzuerkennen, sondern ihn darin zu bestätigen und ihm helfend beizustehen. Bedeutet doch in beiden Traditio-nen Dienst an Gott auch Dienst am Menschen."Wie wichtig auch der theologische Dialog sein mag, so gehört er doch dem "alten Denken" an und Friedmann schreibt ihm höchstens eine "aufklärende Wir-kung" zu. In einem Brief an S. Adelgundis Jaegerschmid vom 2. Februar 1981 begründet er seine Skepsis dem fachtheologischen Dialog gegenüber:
"Auch ich glaube nicht an das theologische Gespräch zwischen Christen und Juden. Viel von dem, was so unnötigerweise schief ging, hat mit der Intellektualisierung des Religiösen zu tun."Er selbst sieht seine Aufgabe nicht darin, den großartigen theologischen Entwurf Rosenzweigs weiter zu denken und zu entwikeln, sondern darin, das in ihm erfaßte "Mysterium" des jüdisch-christlichen Verhältnisses in den Begegnungen von Menschen als zwei eher komplementäre als konkurrierende Grunderfahrungen des Religiösen erfahrbar zu machen. So können wir eine ganze Reihe von Äußerungen Friedmanns finden, die diese "mystische" Bedeutung von Begegnungen, die der endzeitlichen Identität zusteuern, zumindest bestätigen.
So lesen wir z. B. im Rückblick auf eine um 1981 stattgefundene Begegnung mit Urs von Balthasar:
"Wir hatten uns in einem kurzen Gespräch darauf geeinigt, daß es sich für ihn und mich nicht um den üblichen jüdisch-christlichen Dialog handeln konnte, sondern eher um eine Begegnung, bei der zwei Formen der Wahrnehmung des menschlichen Urgeheimnisses sich gegenseitig stützten und ergänzten."In den Briefen an S. Adelgundis Jaegerschmid ist diese Entwicklung sehr eindrucksvoll bezeugt. Am 18. August 1981 schrieb Friedmann an S. Adelgundis:
"Ich (...) glaube, daß die neue lebendige Gemeinschaft - es ist ein neutraleres Wort als "Kirche" - eben aus der Gemeinschaft dieser "Einzelnen" bestehen wird, wobei sich in jeder Person, das was wir traditionell Christentum und Judentum nennen, in eigener Weise vereinen und befruchten wird. Das spüre ich ganz stark in meiner Arbeit mit den Studenten, die mir helfen."Wenige Monate später am 16. Dezember 1981 schreibt er wieder:
"Könnte man nicht sagen, daß wo ein Christ versucht ein guter Christ zu sein und wo ein Jude versucht zu entdecken, was es heißt oder heissen könnte, Jude zu sein, da fliessen die beiden ineinander."Nach circa zwei Jahren am 19. März 1983 heißt es dann erneut:
"Wenn ich an dich oder Urs von Balthasar oder unseren süditalienischen Erzbischof, aber auch an manche unserer jungen Freunde denke, so scheint es doch so etwas wie eine ecclesia invisibilis zu geben und jede Arbeit, die aus Freude getan wird, wird so etwas wie eine Lobpreisung Gottes. Wie glücklich wir sein dürfen, uns gegenseitig zu haben."So verstandener und so gelebter Dialog dient "weder einer sentimentalen oder moralisierenden Selbstbestätigung noch einem politischen oder sozialen Kalkül". Der auch öffentliche Einsatz Friedmanns für diesen Dialog wird durch die Hoff-nung getragen, daß eine oder andere Person sich in dieselbe Richtung bewegt, "auf daß unser Zusammen-leben um ein paar Grade wärmer, um einige Nuancen menschlicher werde". Er erhofft sich, daß von diesen tiefen menschlichen Begegnungen auch Impulse für die notwendige Erneuerung der jüdischen und der christlichen Menschen in ihrer jeweiligen Identität und unverwechselbaren Aufgabe ausgehen. Sie haben es nötig, weil sie durch Exclusivitätsansprüche nicht nur in ihrer Beziehung zueinander gefährdet sind, sondern auch ihre eigene Religiosität - und damit die eigene Menschlichkeit - dem Risiko der Ideologisierung und der geistigen Verkrustung aussetzen.
"Sollten wir nicht, Juden und Christen, gerade heute, da wir gemeinsam vor der Grundfrage menschlichen Überlebens stehen, uns gegenseitig helfen, zum Eigenen zurückzufinden? Haben wir Juden den Gedanken göttlicher Auserwählung nicht allzu oft im Sinne menschlicher Selbstgerechtigkeit praktiziert? Und hat der Anspruch der Universalität von Seiten der Verkünder der christlichen Botschaft nicht allzu oft zu einem allzu weltlichen Triumphalismus geführt? Könnte so nicht die Verschiedenheit der heilsgeschichtlichen Auffassungen zum Segen beider Traditionen gerei-chen und diese wiederum zum Segen einer nach Frieden und Gerechtigkeit lechzenden Welt?"Bei aller Betonung des mystischen Elementes der jüdisch-christlichen Begegnungen dürfen sie also nicht zu einer Weltentfremdung führen, wohl aber zu einer demütigen, aus der gemeinsam getragenen Not kommenden Religiosität, die die Menschen befreit und vereint. Sie bedeuten keinen Rückzug ins Private oder gar ins Sektiererische, sondern vielmehr eine neue Art des religiös motivierten sozialen Einsatzes inmitten der säkularisierten und rein zweckorientierten Gesellschaft. Ziel dieses Einsatzes ist, daß Menschen wieder der Betroffenheit und der Bekehrung fähig werden und damit auch weniger anfällig für eine ideologische Verabsolutierung der innerweltlichen Kräfte oder Bestrebungen. Das eschatologische Element der jüdisch-christlichen Hoffnung, die gerade in den Begegnungen als das eigentlich Zusammenhaltende frei wird, erlaubt eben nicht, daß irgendwelche Nischen der Gemütlichkeit bzw. inner-weltliche Ziele oder Ver-wirklichun-gen mit dem Reich Gottes verwechselt werden.
Friedmanns Kritik am Zionismus und sein Verhalten in vielen aktuellen jüdisch-christlichen Kontroversen wie die um den Karmel in Auschwitz oder die um die Seligsprechung von Edith Stein sind konkrete Anwendungen der Freiheit des religiösen Menschen, der konsequent von der eschatologischen Hoffnung her denkt und handelt. Als Beispiel für diese Freiheit sei eine Stelle aus einem Brief an S. Adelgundis Jaegerschmid vom 25. Februar 1983 angeführt, wo die Absage an die Verwechslung der religiösen Ordnung mit der politischen unmißverständlich ausgesprochen ist:
"Jerusalem, Israel, sie stehen am Ende der Tage. (...) Als ein Refugium erkenne ich Israel vollständig an. Ich erkenne es auch an im Sinne, in dem Buber in Palästina einen zwei-Völker-Staat errichten wollte, um dadurch ein Zentrum einer jüdischen kulturellen Renaissance aufzubauen, aber ich weigere mich absolut diesen heutigen Staat Israel, auch wenn er von Engeln regiert würde, als das anzu-sehen, was die Verheißung des endzeitlichen Jerusalem bedeutet. (...) Wenn die Zionisten heute ihren Staat mit biblischen Zitaten verteidigen, so ist dies für mich reine Blasphemie."Friedmann faßt den eschatologischen Charakter der jüdischen Existenz, die sowohl für seinen Umgang mit dem Christentum als auch für seine Haltung gegenüber manchen Formen des jüdischen Lebens bestimmend ist, unter dem von Rosenzweig verwendeten Begriff des "Exils" zusammen. "Exil" bedeutet für Rosen-zweig wie für Friedmann "nicht die Folge des Verlustes eines uns von Natur gegebenen oder von uns geschich-lich erworbenen Landes, sondern die Ferne von einem göttlich verheißenen Zustand am Ende der Tage." Der Jude lebt und wirkt also in der Abwesenheit der Erfüllung, aber zugleich in der Hoff-nung dieser Erfüllung; und in diesem Sinne ist "das Exil" seine Heimat unabhän-gig davon, ob es einen jüdischen Staat gibt oder nicht. Indem also auf diese Weise der Staat aber auch andere Formen der Beheimatung wie z. B. die Assimilation relativiert werden, gewinnt jene Gemein-schaft an Bedeutung, in der nicht die "Kon-fession" von Menschen, die ihr angehören, das wichtigste ist, sondern vielmehr, ob sie die Substanz ihres Jude- bzw. Christseins einbringen, d. h. ob sie Menschen sind, "die in der Ganzheit ihrer Substanz erfaßt sind von dem göttlichen Paradox, dem sie den Ursprung ihrer Gemeinschaft ver-danken: von Gottes Befehl an Abraham, seinen einzigen Sohn, den Sohn der Verheißung, zu opfern; von Gottes Selbstopfer im menschgewordenen Sohn." So verstandene Gemeinschaft, in der sich Juden und Christen vereinen, obwohl sie auf je eigene Weise, d. h. getrennt, der Erlösung harren, muß von Liebe beseelt werden. Die Liebe ist es ja, die nach der großen Intuition Rosen-zweigs die erlösende Tat Gottes am Ende der Zeit schon jetzt in die Welt hineinträgt, damit die Welt nicht der Versu-chung zum Opfer fällt, das Reich mit seiner Parodie zu verwechseln.
4. "Begegnungen von Personen" statt "Behandlung von Problemem"
Schon in der vorausgegangenen Überlegung zur jüdisch-christlichen communio
tauchte immer wieder ein Wort auf, das für Friedmann ein Schlüsselwort
zu sein scheint: Begegnung. Es ist in der Tat ein Schlüsselwort sowohl
für das Ver-ständnis der Biographie Friedmanns, die durch Begegnungen bestimmt
ist, als auch für das Verständnis seiner Visionen der Zukunft. Begegnungen
waren im Leben Friedmanns von Gott gefügte Ereignisse, die ihn zu dem machten,
was er geworden ist, und die ihm erlaubten, sich selbst ganz einzubringen
in den Prozeß der Überwindung der Sinnlosigkeit durch die Streuung der
Hoffnung inmitten einer Gesellschaft, die dabei ist, die Selbstzerstörungskräfte
zu entwikeln. Durch die Begegnungen soll der verlorene Sinn wieder zum
Teil der gesell-schaft-lichen Erfahrung gemacht werden. In diesem Sinne
ist für Friedmann die Begegnung von Personen, in der sich die vertrauensvolle
Offenheit der Menschen aufeinander ereignet, "der Ort", von dem aus die
Gesellschaft ihre Erneuerung erfahren kann . Friedmann setzt also nicht
auf Institutionen, sondern auf Begegnungen, die als weltweites Netz von
persönlichen Beziehungen dem Hang der Menschheit zur Selbstzerstörung entgegen
wirken können. Was die Begegnung zur Erfüllung ihrer Rolle prädest-niert,
ist die Tatsache, daß in ihr die menschlichen Grenzen nicht als Bedrohung,
sondern dank Zuspruch und Vertrauen als Transzendenz erfahren werden können.
Wir finden zwar bei Friedmann keine Begegnungsphilosophie, wie sie
z. B. ein anderer überlebender Jude, nämlich Emmanuel Lévinas formuliert
hat, aber die Intuitionen seiner vom Chassidismus beeinflußten Mystik der
Begegnung zielen auf die Etablierung einer Denkweise, die die Wiederholung
des Unheils unmöglich machen soll. Das ist auch das Ziel der Begegnungsphilosophie
von Lévinas . In der Erfahrung der Begegnung ist unmittelbar eine Erfahrung
der Unmöglichkeit gegeben, die Wirklichkeit bloß als zu verarbeitendes
Material zu beherrschen. Das Gespräch von Angesicht zu Angesicht, das in
der Begegnung stattfindet, verknüpft den Gebrauch der Vernunft mit dem
unverfügbaren Anspruch der ethischen Verbindlichkeit - mit der Verantwortung
für den Anderen. Dieser Anspruch erschöpft sich nicht in dem Verbot zu
töten, sondern er bedeutet für Friedmann den Einbruch der Tran-szendenz,
die die Grenzen der Angst und der Hoffnungslosigkeit sprengt und zur Verheißung
der Erfüllung dessen wird, was sich zwischen den Menschen als Güte ereignet
hat.
Wer ist also ein Jude?
Er ist ein Mensch, wie Du. Wenn er für Dich ein Fremder geblieben ist,
dann liegt es nicht an ihm. Er ist wohl ein Träger eines Geheimnisses.
Dieses Geheimnis entfremdet ihn nicht von Dir, sondern umgekehrt - nähert.
Denn das Geheimnis, von dem er Träger ist, offenbart Dir Deine Würde und
daß Gott sich Deiner annimmt und Du hast nicht zu fürchten - selbst in
Angesichts des Todes nicht. Er ist also Dein Bruder, der Liebe bezeugt,
ohne der Du nicht sinnvoll leben kannst.
===========================================================================
Hier die deutsche Abschrift des Gespräches mit Herrn Prof. Simon Lauer
(Luzern). Es wurde aufgezeichnet am 9. April 1991 in Krakau am Rande der
Tagung "The Shoah. Implications for Christian and Jewish Theological Thinking".
Die polnische und die russische Überset-zung dieses Gespräches wurden veröffentlicht.
Communio fidelium. Z prof. Simonem Lauerem rozmawia Adam ¯ak SJ, t³.
Tadeusz Zatorski, w: Znak 432 (1991) 5, 82-86
Bjesjeda o. Adama ¯aka s Simonom Lauerom, w: Woprosy Fi³os-ofii 5/92,
70-73
===========================================================================
"COMMUNIO FIDELIUM"
Mit Prof. Simon Lauer spricht Adam ¯ak SJ
Adam ¯ak SJ: Sie gehören einer traditionsreichen, jüdischen Gelehrtenfa-mi-lie, die den berühmten Namen Luria trägt. Die Heimat dieser Familie war Polen. Ihre Urahnen haben im 17. Jh. in Lublin gelebt. Ein berühmtes Mitglied Ihrer Familie, Rabbi Joel Sirkes, eine Autorität in den jüdischen Fragen, hat in Krakau gelebt und ist hier hinter der Remu Synagoge begraben; das Grab ist zu sehen. Ihr Vater stammte aus Bobowa in der Nähe von Nowy S¢cz. Die Pflege der Tradition durch das tief-sin-ni-ge Lernen von Thora ist eine Säule des jüdischen Lebens. Bis dahin stehen Sie voll in dieser Tradition. Was Sie aber aus-zeichnet ist, daß Ihr Lehren und Lernen nicht nur das Jüdische sondern auch das Christliche umfaßt. Sie sind ja Professor an einer Fakultät, wo katholische Theologie gelehrt wird. Sie sind Mitherausge-ber, zusammen mit Prof. Clemens Thoma, einer sehr wichtigen Bücherreihe «Judaica et Christia-na», die schon 12 Bände umfaßt und - wie ich höre - ein 13. unterwegs sei. Sie sind auch der Mitbegründer des Instituts für Jüdisch-Christliche Forschung an der Fakultät für katholische Theologie in Luzern. Das scheint irgendwie den Rahmen des jüdischen Lehrens und Lernens zu sprengen. Finden Sie für diese Verbindung des Jüdischen und des Christlichen in Ihrem Lehren und Lernen eine Erklärung in der Tradition Ihrer Familie oder sind Sie dazu auf anderen Wegen gekommen?
Prof. S. Lauer: Ja, es ist etwas in der Familie. Ich weiß, daß mein Großvater mütterlicherseits, der orthodoxe Rabbiner und Dozent an dem orthodoxen Rabbinerseminar war, von seinen Kindern verlangt hat, daß sie wenigstens einmal das Neue Testament gelesen haben. Das gehörte einfach zur Bildung eines Menschen der in diesem Kontext lebt. Übrigens, das ist jetzt vielleicht nicht theologisch, aber das zeigt die Atmosphäre; mein Großvater war Rabbiner im damaligen Westpreußen, heute Polen, in einer kleinen Stadt in der nähe von Toruº. Das war deutsch beherrscht, deutsche Beamte, deutsche Schulleitung, deutsche Lehrer aber eine starke polnische, ländliche Bevölkerung, Grundbesitzer. Die deutschen Protestanten waren nicht immer sehr nett mit den katholischen Polen. Das hat meine Mutter mir oft erzählt, wie sie in der Mädchenschule dieser Stadt miterlebt hat, wie die deutschen Lehrer katholischen Schülerinnen behandelt haben. Das war vor 90 jahren. Aber, wenn der Bischof in diese kleine Stadt kam, da war die ganze Stadt geflaggt, auch von Protestanten und von Juden. Mein Großvater hat seinen Leuten gesagt: jetzt kommt der Bischof und bitte hängt die Fahne heraus. Das war bereits ein gewisser Kontext. Dann hat mein Vater in den späten zwanziger und in dreißiger Jahren in Deutschland mit protestantischen Theologen kontakt gehabt. Und solche Kontakte waren in der Schweiz während des Krieges auch vorhanden. Meine Eltern hatten ein Flüchtlingslager zu betreuen und die Zusammenarbeit mit dem protestantischen Ortspfarrer und mit dem katholischen Kaplan war ausgezeichnet. Solche Atmosphäre in der Stadt, wo wir heimatberechtigt sind, ist immer da gewesen; es ist eine weltoffene Stadt. Solche Kontakte waren immer da. Und dann durch meine Biographie bin ich in solche Kontakte gekommen. Schon in der Schule, einer meiner Klassenkameraden ist protestantischer Pfarrer geworden. Wir hatten eine sehr kleine Minder-heit von Katholiken; es waren nie mehr als zwei Katholiken in der Klasse. Dann später als Gymnasiallehrer hatte ich einfach viel Kontakt mit protestantischen und katholischen Religionslehrern. Dann kommt noch etwas dazu. Ich hatte einen Lehrer in Musiktheorie. Es war ein Holländer, der sich sehr stark mit den östlichen Religionen abgegeben hat. Durch ihn bin ich dazu geführt worden Indisches und Chinesisches in englischer und deutscher Übersetzung zu lesen. Das hat meinen Horizont einigermaßen geweitet; das verdanke ich diesem Mann im hohen Maße. Das darf ich ruhig sagen. So bin ich mit dem Christentum immer im Kontakt. Ich habe immer in der christli-chen Umgebung gelebt. In der Schweiz sind wir Juden eine kleine Minderheit - 35 Promille, die sehr stark integriert ist. Dann durch Freunde kam die Bekanntschaft mit Rudolf Schmid, der damals Alttestamentler in Luzern war; dann auch adie Bekanntschaft mit Clemens Thoma, der 1971 nach Luzern kam. Da wurde der Lehrstuhl gegründet und 1974 haben wir mit der erwähnten Buchreihe angefangen. Die Zusammenarbeit lief einige Jahre bevor das Institut gegründet wurde.
A.¯. Das ist eine äußere Erklärung. Sie haben nur äußere Umstän-de genannt, die Ihnen diese Weitsicht, diese Einfühlsam-keit in das Fremde gegeben haben. Gibt es vielleicht einen Religiösen Trieb in diese Richtung?
S. L. Sicher, ein Gefühl für Religiöses, das sich nicht auf das Theologische beschränkt. Ich sehe einen Unterschied, den man allerdings im praktischen Leben ausgleichen sollte: es gibt das systematische theologische Denken - das ist eine rationale Angelegenheit mit dem lumen naturale. Dann gibt es auch das religiöse Gefühl, das Gefühl für das Tremendum, für das Fasci-nosum, die althergebrachten Bräuche, die sich vielleicht theologisch nicht ganz gut rechtfertigen lassen, vielleicht sogar etwas bedenklich sind, die aber doch zum mensch-lichen Leben einfach gehören. Jemand hat einmal zu mir gesagt und ich finde das ein sehr gutes Wort, wir brauchen nicht nur eine sitzende Theologie, sondern auch eine kniende Theologie. Ich verstehe das, obwohl wir Juden während des Gottesdienstes nicht niederknien. In gewissem Sinne würde ich das glatt übernehmen.
A.¯. Ich war sehr beeindruckt als Sie während einer Tagung hier in Krakau darum bemüht waren, den Sabath zu heili-gen. Heute gibt es viele Katholiken, die den Sonntag nicht mehr heiligen, die sich verbergen. Sie haben sich nicht verborgen. Sie haben uns gesagt, Sie seien nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit erreichbar, weil dann der Sabath anfängt. Ich sah, als wir im Restaurant waren, daß Sie für sich Gerichte nicht nach dem Geschmack, sondern nach ihrer Unbedenklichkeit gegenüber dem religiösen Gesetz ausgesucht hatten. Das zeigt mir, daß Ihr Leben wohl von einem religiösen Rhythmus geprägt ist, der alles andere als oberflächlich ist. Bei den Diskussionen habe ich bemerkt, daß Sie eine besondere "Antenne" für die Glaubenserfahrung auch eines Christen haben. Ich darf an die Kontroverse mit Dr. Riegner bei einer früheren, im Rahmen der Auschwitz-Woche von KIK organisierten Tagung erinnern, wo es um den Sinn einer Deutung der Sho'ah-Erfahrung ausgehend vom Kreuz Jesu ging. Da habe ich mich mit Ihnen in Gemeinsamkeit gefühlt. Sie haben eine theologische, vom Glau-ben her begründete Deutung eines so schrecklichen Ereignisses, wie es Sho'ah war, gegen eine rein soziologische, psychologische Erklärung voll unterstützt. Einer fühlt sich von Ihnen nicht nur verstanden, wenn es um die Mitteilung der Glaubensüberzeugungen geht, sondern einer fühlt, daß Sie mit ihm verbunden sind, ich meine - im Glauben verbunden; was ich ausdrücken will ist, daß sich in der Begegnung mit Ihnen nicht nur communicatio, son-dern auch communio ereignet. Ich vermute mehr dahinter als nur die Sicherheit eines Studioso, der sich der eigenen Sache sicher ist und sich deshalb den Luxus erlauben kann, sich mit anderen einzulassen. Könnten Sie dazu Stellung nehmen?
S. L. Ja, ich erinnere mich an diese Kontroverse. Ich erinnere mich noch, wie Dr. Riegner mich gefragt hat: "Haben Sie eine theologische Erklärung für die Sho'ah?" Ich habe gesagt: "Nein". Dann hat er gesagt: "Sehen Sie?!" Dann habe ich gesagt: "Halt! Die Tatsache, daß ich keine Erklärung habe, bedeutet nicht, daß es keine gibt. Ich weiß sie noch nicht, ich habe nicht alles gelesen, was geschrieben worden ist. Ich vermute, daß wir noch etwa Jahrzehnte brauchen, um etwas Vetretbares sagen zu können, aber ich würde nicht schon heute sagen, daß es überhaupt keine Erklärung gibt." Das ist mal ein Punkt. Das andere: Gläubigkeit ist für mich so unteilbar wie z. B. die Gerechtigkeit. Also sagen wir: Ein Staat hat ein Strafgesetzbuch mit einem ganz bestimmten Tarif. Wenn Herr A den Herrn B umbringt, dann bekommt er so und so viele Jahre Zuchthaus. Und wenn jetzt Herr C hingeht und Herrn D umbringt, dann muß er genau gleich viel bekommen, wenn die Umstände gleich sind. Wenn Herr A für seinen Mord 12 Jahre bekommt und Herr C nur 6 Monate, dann ist das nicht in Ordnung. Für mich ist die Gläubigkeit, das Glauben-Können, das Bereit-Sein zum Glauben auch unteilbar. Gut, ich glaube nicht dasselbe, was ein Christ glaubt. Ich glaube vielleicht nicht auf dieselbe Weise wie ein Christ, aber wenn ich für mich das Recht bean-spruche, zu glauben, gläubig zu sein, gläubig zu leben, ist das selbstverständlich, daß jeder andere dasselbe Recht hat. Das heißt, es gibt eine communio fidelium. Das ist die "Antenne", von der Sie sprechen.
A. ¯. Das eben spürt man, wenn man hört, wie Sie bei dieser Tagung
jetzt in Krakau die Dokumente der Kirche analysiert haben, die nach "Nostra
Aetate" erschienen sind und das Verhältnis der katholischen Kirche zum
Judentum zum Hauptthema haben. Da merkt man, daß es nicht eine Analyse
eines Außenseiters ist, sondern eines Menschen, der sich freut, der mitvollzieht,
was er da richtig findet, der auch das kritische Wort so anbringt, daß
niemand verletzt ist. So sehe ich, daß diese communio zum Ausdruck kommt;
eine communio, die auf der dekla-rativen Ebene sehr schwer auszudrücken
ist. Sie liegt der Art und Weise, wie Sie auftreten, zugrunde.
Daran möchte ich noch eine weitere Frage anschließen
Sie sind ein Kenner der schwierigen Geschichte der Feindschaft zwischen
Christen und Juden, der anti-communio also. Durch Ihre Studien kennen Sie
diese Geschichte auch in ihren Motivationen und in ihren Rechtfertigungen.
Gibt es etwas in der Geschichte, was irgendwie erklären könnte, warum es
so lange gedauert hat, bis wir uns näher kämen? Ich finde keine Erklärung
für die Tatsache, daß die katholische Kirche meines Wissens, wenn sie die
Märtyrer verehrt hat, nie die Täter irgendwie angegriffen hat. Sie hat
das Zeugnis ihres Martytriums dankbar angenommen, aber die Täter hat sie
nie verteufelt. Und ausgerechnet einzig im Falle des Todes Jesu geschieht
etwas, was mit dieser Haltung der Kirche dem Martyrium gegenüber im Widerspruch
zu sein scheint. Kann aus der Geschichte irgendwie erklärt werden, warum
in diesem einzigen Falle auch das elementare Gebot der Liebe vergessen
wurde?
S. L. Ich kann jetzt nur eine Vermutung äußern. Der Tod der Märtyrer
nach Jesus muß wohl im Hinblick auf Jesus gesehen werden. Jesus war im
gewissen Sinne nicht ein Märtyrer, sondern sein Tod war ein Sühnetod für
alle Menschen. Sein Tod war un acte gratuit, lateinisch gratuito. Der Tod
Jesu ist wesentlich etwas ganz anderes als der Tod der Märtyrer später.
Wie weit die Verteufelung der Täter beim Tod Jesu echte christliche Tradition
ist, oder eine theologisch anfechtbare Tradition, die ins Gebiet der Religion
im pejorativen Sinne gehört, das ist nicht meine Sache zu beurteilen. In
Luzern, wo ich wohne, heißt einer der beiden Hausberge Pilatus. Es gibt
eine alte Sage, daß der Pilatus immer am Karfreitag dort herumgeistern
muß und er findet keine Ruhe. Es scheint, daß das im Grunde eine germanische
Legende ist. Dieser ruhelose Geist, der übrigens dasselbe ist wie der wandernde
Jude, ist keine jüdische und keine christliche, sondern eine germanische
mythologische Figur.
Jetzt die Frage, warum es so lange gedauert hat. Ja, wie lange hat
es gedauert? Positive Beziehungen zwischen Juden und Christen hat es ja
immer wieder im Laufe der Geschichte gegeben. Im Mittelalter in Spanien,
in Frankreich. Die klassischen jüdischen Bibelexegeten des Hochmittelalters
in Nordfrankreich und im Rheinland waren im ständigen Dialog mit den christlichen
Exegeten ihrer Zeit und zwar nicht nur einige wenige Jahre, sondern über
Generationen. Das XVIII. Jahrhundert ist voll von Dialogversuchen, die
manchmal stark ins Heretische gehen; seltener finden wir ein Versuch auf
der Ebene der offiziell etablierten Kirchen - die Zeit war damals nicht
reif dafür. Es war ein Zeitalter, das bereit war, zu sagen: bis dahin reicht
der menschliche Verstand und das weitere ist die Sache des Herzens und
kann nicht diskutiert werden. Das ist auch etwas, was in einem katholischen
Dokument gesagt wird, aber das ist schon 200 Jahre alt. Vermutlich haben
das die Autoren dieses Dokuments nicht gewußt; das ist vorläufig noch Sache
der Spezialisten des XVIII. Jh., noch nicht so divulgiert. Und heute sind
wir doch in einer Welt, die in fürchterlicher Weise pendelt zwischen den
beiden Extremen - zwischen einer bis auf die Spitze getriebenen Rationalität
auf der einen und dem Ruf "ab nach Indien", wo man nur zu Fuß erst nach
drei Tagen hingelangt, wo von Zivilisation gar nichts ist auf der anderen
Seite; diese beiden Extreme sind da. Da begreife ich, wenn man versucht,
irgendwo eine Mitte zu finden, wo der Verstand und das Herz miteinander
zur Harmonie, wo beide zu ihrem Recht kommen, wo beide sprechen dürfen.
Die Arbeit, die gerade bei dieser Tagung geleistet wird, beeindruckt mich
sehr. Das ist auf der einen Seite strenge Exegese mit wissenschaftlichen
Methoden und doch getragen von einem Engagement, das aus dem Herzen kommt,
denn die Sho'ah, die den Titel für diese Tagung abgibt, hat ja noch keiner
begriffen. Das glaube ich sagen zu dürfen, ohne jemandem Unrecht zu tun.
Es ist nicht nur die Überlegung: es darf so etwas nicht passieren, sondern
das Gefühl, daß so etwas nicht mehr passieren darf.
Eine Zeit der christlich-jüdischen Begegnung war die frühe Renaissance.
Das war eine Krisenzeit. Auch die Zeit während und nach dem dreißigjährigen
Krieg, die Barockzeit. Es war eine Zeit, die in ganz Europa von Atlantik
bis zur Weichsel fürchterlich war. Wir sind also wieder in einer bestimmten
Weltstunde, in einer bestimmten geschichtlichen Situation, die nicht ganz
so neu ist.
A. ¯. Ja, aber dann gab es in der Geschichte immer wieder Rückfälle. Diese Rückfälle waren auch sehr dauerhaft und haben sehr nachhaltig gewirkt, sicher nachhaltiger als die Perioden der Begegnung, als diese Stunden, die die Begegnung begünstigt haben. Besteht wieder die Möglichkeit, daß wir wieder einen Rückfall erleben?
S. L. Ich kann diese Möglichkeit nicht ausschließen. Hoffentlich erlebe ich das nicht mehr. Aber ganz ausschließen würde ich das nicht.
A. ¯. Bleiben wir bei der Gegenwart.
Sie kennen den Hirtenbrief der polnischen Bischöfe über Kirche und
Judentum, der vor kurzem in den polnischen Kirchen verlesen wurde. Gibt
es darin etwas - vor dem Hintergrund anderer, zahlreicher kirchlichen Dokumente
- was Sie in irgendeine Weise ganz persönlich angesprochen hat?
S. L. Ja, zwei Dinge. Das eine ist, daß die polnischen Bischöfe sehr
scharf dagegen protestieren, daß man die polnische Kirche und die Polen
überhaupt ganz allgemein als besonders antisemitisch darstellt. Ich begreife
das. Im Laufe dieser Tagung, beim Essen habe ich mit jemandem scharf diskutiert.
Ich bin gegen die Pauschalurteile. Ich bin dagegen, daß man sagt die Juden
und daß man sagt die deutschen Juden oder die Israelis und da bin ich konsequent
auch dagegen, daß man sagt die Polen. Daß Polen Juden gerettet haben, das
weiß ich ganz direkt. Ich kenne seit langem eine jüdische Frau, die während
des ganzen Krieges als Mädchen in Polen bei nicht Juden versteckt war.
Das sind keine Geschichten. Das weiß ich. Da kann man nicht pauschal urteilen;
das kann man so wie so nicht. Das hat mich betroffen gemacht, weil ich
weiß, daß in unseren Kreisen viel pauschalisiert wird.
Das andere, das ist etwas sehr Bewegendes. Die Art wie die polnischen
Bischöfe den Antisemitismus auch in der kleinsten Form, der Form von Unterlassung
von Hilfe, ganz klar als Sünde brandmarken. Und was mich sehr bewegt hat
und was mir zeigt, daß das nicht leere Worte sind, die als Alibiübung geäußert
werden, ist das, was Prof. Chrostowski erzählt hat, daß Leute Antisemitismus
im Beichtstuhl gebeichtet haben. Das Zeigt, daß dieser Hirtenbrief eingeschlagen
hat. Ich weiß nicht ob irgendein kirchliches Dokument eine solche Wirkung
gehabt hat.
Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, was Sie am Anfang formuliert
haben, indem Sie sagten, daß es nicht so aussieht, als könnte ich mir das
als Luxus erlauben, mit anderen zu kommunizieren. In gewissem Sinne ist
es ein Luxus, oder sagen wir genauer - es ist ein Risiko. Sobald man mit
Einem in einen ernsthaften Dialog tritt, muß man sich auf ihn einlassen
und dann bleibt etwas hängen. Das ist ganz klar. Ich glaube, mir das erlauben
zu können; ich halte den Dialog für unausweichlich und ich muß das machen.
Das ist meine Überzeugung. Es ist aber nicht jedermann Sache. Mancher hat
mit Recht eine gewisse Furcht davor.
A. ¯. Das kann man wohl auch von den Christen sagen, daß der Dialog
nicht jedermann Sache ist. Es ist ein gewisser "Luxus", der mehr als auf
der Sicherheit des Studioso, auf dem Sich-in-der-Gottes-Hand-Wissen, auf
dem Vertrauen, von Gott auch in der Begegnung geführt zu werden, beruht.
Mit der nächsten Frage möchte ich an das Thema der Tagung anknüpfen.
Gibt es etwas, was einem gläubigen Juden das Kreuz Jesu sagen kann im Hinblick
auf die Erfahrung von Sho'ah? Ob das, was wir Christen in der Glaubensdeutung
der Todes Christi zum Ausdruck bringen, einen gläubigen Juden auch ansprechen
und die Erfahrung von Sho'ah irgendwie beleuchten (nicht rechtfertigen!)
kann?
S. L. Rein gefühlsmäßig, würde ich sagen - nein, weil ich von der jüdischen Tradition her Erklärungsmodelle suchen muß. Ich kann nicht anders. Aber ich kann begreifen, daß für Christen das Kreuz das Zeichen ist, mit dem man - wie Sie sagen - das Geschehen beleuchten kann. Vielleicht nicht das Ganze, aber vielleicht ein Lichtkegel heraufwerfen. Das begreife ich sehr gut und deshalb stört mich persönlich das Kreuz nicht, das die Karmelitinnen neben dem Lager aufgerichtet haben; deshalb stört mich das Kreuz von der sogenannten Kommandantur in Birkenau, das die Straße gewissermaßen beherrscht, nicht. Das stört mich nicht. Ich kann natür-lich anfangen, theologisch zu re-flektieren, wie sind die Opfer von Auschwitz gestorben. Sind sie gestorben, wie seiner Zeit der Jude Jesus gestorben ist? Ist das vergleichbar? Große Frage: wie ist Edith Stein gestorben? Ich nehme an, daß sie - theologisch gesprochen - wie Jesus gestorben ist, wenn man so sagen darf, sit venia verbo, nämlich Sühnetod. Das gibt im Judentum auch, aber nicht in dieser Stärke, nicht in dieser Zentralität wie im Christentum. So kennen wir das Sühneleiden oder das stellvertretende Leiden nicht in unserer Tradition. Mir persönlich scheint wichtig, daß nicht 6 Millionen umgekommen sind, sondern 6 Millionen mal ein Mensch. Und wenn man fragt, ob Gott dort war, dann würde ich sagen, ja und zwar bei jedem einzelnen in seiner Todesstunde. Genau so wie Gott in der Todesstunde sowohl bei Jesus war als auch bei dem Häscher neben ihm. Das ist eine gängige jüdische Lehre, daß bei jedem Sterbenden Gottes Schechina da ist, daß die praesentia specifica Dei da ist. Insofern könnte ich jetzt, nach einer gewissen Reflexion die Frage mit ja beantworten. Ich mußte aber auf das Rationale umschalten.
A. ¯. Der Papst hat in der Synagoge von Rom die Juden als "unsere älteren Brüder" bezeichnet. Fühlen Sie die Christen als jüngere Brüder?
S. L. Ich würde einfach sagen - als Brüder.
A. ¯. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
 Zurück
zur Home Page
Zurück
zur Home Page